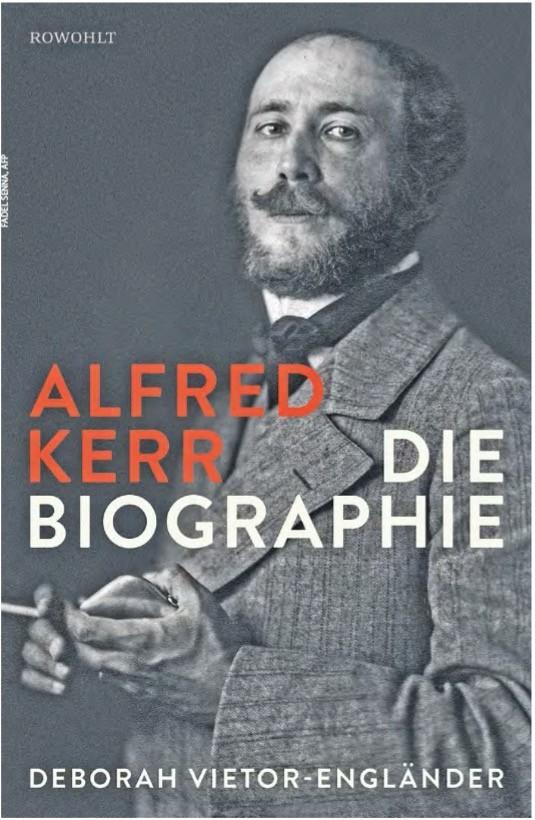
Von Dr. Ludger Joseph Heid
In der deutschsprachigen Literatur- und Theaterkritik hat es vor 1933 an klangvollen Namen gewiss nicht gemangelt: Maximilian Harden, Siegfried Jacobsohn, Karl Kraus, Kurt Tucholsky, Herbert Jhering, Hermann Sinsheimer und viele mehr. Doch einer überragte alle: Alfred Kerr (1867-1948).
Ihm, der in der Gegenwart schon ein wenig vergessen schien, widmet die Literaturwissenschaftlerin Deborah Vietor-Engländer eine Biographie, an der sie 15 Jahre lang gearbeitet hat. Die Mühewaltung hat sich gelohnt, und man mag sich fragen, warum erst jetzt, fast 70 Jahre nach seinem Tod ein solches Werk erscheint. Ein großer Wurf, der durchaus eine kritische, wenn auch sympathische Distanz zum Untersuchungsgegenstand wahrt.
Die Biographin zeigt sich in ihrem Kerrschen Lebensbericht als eine glänzende Erzählerin. Es ist eine üppige, elegant und fesselnd geschriebene Biographie, gefüllt mit dem prallen Leben des brillanten Großkritikers. Mit ihrem Bericht durchmisst Vietor-Engländer acht Dezennien des Kerr‘schen Lebens und beleuchtet zugleich den kulturellen Kosmos des Apostrophierten, was den heutigen Leser immer noch staunen lässt. Staunen über einen unbestechlichen Freigeist, der frech und furchtlos war, der auch vor großen Namen nie zurückschreckte.
Mit Kerr flaniert Deborah Vietor-Engänder durch das pulsierende Berlin der Wilhelminischen und Weimarer Jahre, wo die Theater vor Neuerungen sprühten, die Literatur ganz neue Töne anschlug, neue schöpferisch-kreative Kunst und Wissenschaft vorwärts stürmten, ein neues Denken sich Bahn brach, nicht immer im humanistischem Geist. Und Kerr mittendrin, bewundert und gehasst, leichtfüßig, witzig, polarisierend und immer auf der Höhe der Zeit, manchmal ihr vorauseilend.
Kerr war zu seinen Lebzeiten nachgerade berühmt, umstritten, für manche auch berüchtigt. Seiner spitzen Feder wegen. Für Karl Kraus war er eine „Feuilletonschlampe“, für Moritz Heimann dagegen ein „Kritikergenie“. Kerr ging stets scharf zur Sache. Er galt als der „schärfste Verreißer“, als kritische Instanz. Über sich selbst sagte er in einer Mischung aus Stolz und Eitelkeit: „Ich beherrsche die deutsche Sprache“. Das sollte nichts Anderes bedeuten, als dass er der „Herr“ der Sprache und diese ihm zu Willen war. Kerrs Sprache war seine eigene Schöpfung. Und seine Sätze waren knapp, schroff, weckend, prägnant. Ein ganz eigener – neuer – Ton. Die Kerr-Sprache.
Es war das inspirierte Leichte, das ihn auszeichnete, jemand, der imstande war, spielerisch Wortkunstwerke aufzutürmen, ein Schreibkünstler, der virtuos das Ja im Nein, das Nein im Ja verstecken konnte. Kurz: Die Kerr-Haltung. Er verbarg nicht, was er fühlte. Der Leser sollte wissen, was in ihm, dem Kritiker, vorging beim Zusehen eines Stücks. Er war das Original. Unvergleichbar, in Form und Sprache.
Kerr ist charakterisiert durch das hohe Tempo, das er in seinen Texten anschlug, das war sein Markenzeichen. Zielen, schießen, treffen, so verfuhr er in seinen Kritiken und treffgenau war er fast immer. Seine Methode war die Verknappung, die Kürze, mit der er Wirkung erzielte. Sogar in der Verkürzung seines Geburtsnamens – aus Kempner machte er Kerr – zeigte er sehr früh ein Gespür für die Einzigartigkeit und Wirkung. Stakkatoartige Sätze, Satzfetzen, die durch virtuos gesetzte Satzzeichen der gewünschten Aussage eine zusätzliche Wirkung zu schaffen vermochte, das war sein unnachahmlicher Stil. Punkt, Komma, Gedankenstrich, Ausrufe- oder Fragezeichen punktgenau platziert setzte er als Waffe ein. Er verstand es, das, was er sagen wollte, sprichwörtlich auf den Punkt zu bringen. Und am Ende stand dann die Pointe – und der Verriss oder das Lob. Wenn man mit dem Lesen seiner Kritiken begann, wollte man unbedingt weiterlesen. Das Publikum war begierig, seine Kommentare zu lesen. Seine Texte hatten immer zwei Aspekte: Was er sagte und wie er es sagte. Das Wie übertraf oft das Was.
Seine Biographin versucht trotz der ihr zur Verfügung stehenden Materialfülle dieses Tempo mitzugehen, ohne zu überpacen, so dass der Leser mühelos folgen kann.
Kerr liebte das Wortspiel, das Zusammenfügen scheinbar sich widersprechender Bedeutungen, die Absurdität, das Wortschöpferische. Er war ein Meister der „aphoristischen“ Kritik, der für die Anerkennung der Kritik als eigenständige literarische Gattung kämpfte. Für das eigene Schaffen prägte er den Begriff der „Davidsbündlerkritik“ und bekannte sich zu „Schleuder und Harfe“ als Symbole des kritischen Werkzeugs. Kerr war besessen vom Schreiben. Kein Tag verging, ohne dass Sätze geformt, Wörter gefunden und gebunden wurden und der Augenblick eingefangen, der Gedanke formuliert war. Er war ein virtuoser Sprachakrobat.
Indes war Kerr mehr als ein Theater- und Literaturkritiker, er war Journalist, Essayist, Lyriker und (Reise-)Schriftsteller. Seine öffentliche Bedeutung zog er aus der Grenzüberschreitung von Literatur und Theater in die politische Polemik. Bei all dem war er auch ein Entdecker von Literatur sowie ein einflussreicher Vermittler in der Literatur. Kerr forderte, dass Kritik eine gleichberechtigte Kunst neben der Dichtung und der Kritiker ein Dichter sein solle. Dieser Maxime blieb er stets treu. Was Kerr schrieb, gewann zunehmend die Tendenz, selbst Literatur zu sein. Er lebte in und mit der Literatur.
Den ersten Text der „Literarischen Ermittlung“ aus Kerrs Feder, eine Lessing-Verteidigung, schrieb er – zwischen Abitur und Studienbeginn - mit 19 Jahren, das war im Jahre 1887, und damit hatte er zugleich seinen Ton gefunden. Bereits hier klingen bei Kerr analytische Schärfe, Polemik, Ironie und Witz an, Lust am Streit, die vielen Literaturkritikern zu Eigen ist. Beispiel gefällig? Als junger Kritiker (1894) schulte er am Schlechten seinen Witz, übte sich in der enthüllenden Pointe. Über das Theaterstück „Das Fest auf der Bastille“ heißt es bei ihm: „Ich halte das ‚Fest auf der Bastille’ nicht für ein Drama, sondern für ein Unglück“. Vietor-Engänder meint: „Er war der Intellektuelle, der eine eigene herausfordernde Sprache sprach, die sich eignete für den Witz wie für die Peitsche, an dem man sich rieb, den man nicht auslassen konnte“.
Die Kerrschen Protagonisten, das waren Ibsen, Schnitzler, Wedekind und Hauptmann (mit dem er 1933 brach) und nicht zuletzt Heine.
Mit Heinrich Heine fühlte er sich brüderlich verwandt. Zwischen dessen Tod und Kerrs Geburt lagen nur elf Jahre. Ihrer beider Lust zu leben, ihr Witz, ihre Ironie, ihre literarische Existenz waren sich nah. In jüdisch-religiöser Konnotation schrieb Kerr: „Wir gedenken des Dichters Heinrich Heine, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt“. Die „chaotische“ Else-Lasker-Schüler entdeckte er, auch wenn er sich – anfangs – über deren „Altes Testament“ mokierte. Und die Lasker-Schüler dankte es ihrem Förderer mit einem Gedicht: „Was Dr. Kerr bedeute / für die Literatur von heute - / Ein Silberling im Brot“.
Und wie hielt er es, der aus einem jüdisch-orthodoxen Haus in Breslau stammte, mit dem Judentum? Kerr empfand die Herkunft „von diesem Fabelvolk“ immer als etwas Beglückendes, obwohl er von der Sprache der Juden nichts wusste als die für ihn „gewaltig schönen“ sechs rauen Riesenworte: „Schma Jisroel, Adonai Elohenu Adonai Jechod“. Diese Worte hatten für ihn „ewige Geltung für meine Phantasie“, so bekannte er 1928 in seinem „Lebenslauf“. Je mehr er als Jude angegriffen wurde, desto kämpferischer wurde er. Er scheute keinen Konflikt. Kerr empfand sich als Deutscher und Jude zugleich, sah darin keinen Widerspruch und keinerlei Problem, sich in der deutschen Öffentlichkeit bemerkbar zu machen, auch wenn ihm bewusst war, dass er von vielen nur als Jude wahrgenommen wurde. In seinen Worten klingt das so: „Ich fühle mich durchaus deutsch – auch wenn ich mich geschmeichelt erinnere, ein Mitglied des Bibelvolkes zu sein, dem die führenden Herrn Moses, Christus, Spinoza und Karl Marx entsprossen sind“.
Fünf Jahre bevor Theodor Herzl 1898 Palästina zum ersten und einzigen Mal besucht und sich schaudernd von den ärmlichen Judengestalten und vom dortigen Unrat abgewandt hatte, traf Kerr im April 1903 in Jaffa ein. Als er Palästinas Küste erblickte, war er ganz ergriffen und notierte in sein Reisetagebuch: „Die Tränen stiegen mir auf“. Neun Tage blieb er in Jerusalem und dieses Erlebnis änderte sein Verhältnis zum Judentum: „Gelobtes Land. Ernstes Land und Schönheitsland, Frühland! Frühlingsland! Judenland!“ Alles erinnerte ihn an die Verfolgung eines Volkes – seines Volkes. Auf die diasporische Verfolgung anspielend schrieb er: „Ich bin ja nach den Martern der Jahrtausende heute auch heiter geworden. Und schlage die Harfe; wie keiner sie schlug seitdem. Weiß hebräisch nicht zehn Worte. Dennoch klingt in mir der Klang: der gedrängten Symmetrie; der Vaterschaft; Gottes“.
An jüdischen Dingen war er sehr interessiert und das drückte er auch auf seine ihm eigene Art aus. Ihm ging es dabei weniger um ein zur Schau getragenes Judentum, sondern um ein mit Aufrichtigkeit und Würde gelebtes und verteidigtes jüdisches Selbstverständnis. Das klingt bei ihm so: „Jeder feige Vertusch-, Verkriech-, Versteckjude (soll) die Gicht kriegen, Knollen am Popo, und zerspringen“. Gerade das Kämpferische war für Kerr Inbegriff des Judentums. Jedes Verleugnen des eigenen Judentums bedeutete für ihn umgekehrt, Wasser auf die Mühlen der Antisemiten zu schütten.
Das meistgespielte und bekannteste Stück des „Jüdischen Künstler-Theaters“ war der „Dibbuk“, der sogar von nichtjüdischen Bühnen häufig gespielt wurde. Auch Max Reinhardt inszenierte dieses Stück. Über eine Aufführung dieses mystisch-kabbalistischen Dramas schrieb Kerr im „Berliner Tageblatt“: „Das Jüdische Künstlertheater ist sozusagen eine Dorfschmiere mit Genialitätsblitzen. Eine Edelschmiere - von hochstehendem Ineinanderspiel [...]“. Und weiter heißt es bei ihm über An-Skis jiddisches Stück im Oktober 1921(!):
„Es ist eine fremde Sprache: Man versteht nur Eini¬ges... Nirgends Gemauschel - sondern man fühlt eine geschlos¬sene Eigensprache. Höchst merkwürdige Bekanntschaft... Das ‚Yiddisch’ ist ja praeter-propter mittelalterliches Deutsch. Ein Beweis, dass in Deutschland Juden längst heimisch waren, längst deutsch redeten, als die Ahnherrn preußischer Hakenkreuzschnäbel noch dunkle Slawendialekte piepsten. Die heut über ‚Landfremde’ das schmutzige Mundwerk aufreißen, waren dazumal diesem Land sehr fremd. Es ist ein Schwindel wie die übrigen“.
Es vergingen nicht einmal drei Stunden bis Kerr sich von einem Warnanruf am 14. Februar 1933, die Nazi-Behören beabsichtigten, ihm den Pass entziehen, als Exilant auf tschechischem Boden wiederfand – mittellos, brotlos. Nichts war zuvor gepackt, es gab kein Konto im Ausland. Kerr hatte, wie die meisten deutschen Juden, die Inmachtsetzung Hitlers und dessen schnellen, rigorosen judenfeindlichen Griff nach der Macht nicht für wahrscheinlich gehalten. Für die nächsten fünfzehn Jahre musste er das bittere Brot des Exils essen.
In der Kerr‘schen Diktion liest sich das so: „Man geht nicht zum Vergnügen ins Exil“. Seine nächsten Stationen waren: Tschechoslowakei, Schweiz, Frankreich, Großbritannien. Er wurde ausgebürgert, sein Besitz – darunter wertvolle Heine-Autographen – wurden öffentlich versteigert und man aberkannte ihm seinen Doktortitel. Desillusioniert schrieb er: „Meine Bibliothek besitzen die Nazis. Wie alles, was mein war; darunter Deutschland“.
In der Nazi-Presse wurde er als einer der „übelsten Asphalt-Literaten“ geschmäht. Bei Kerr machte sich Verzweiflung breit. Immer wieder musste er entwürdigende Bettelbriefe schreiben. Ein Hilferuf ging an jüdische Mäzene nach New York: „Ich habe für die Juden soviel getan. Vier oder fünf Yankeehebräer könnten sich schon zusammentun und mir eine Pension aussetzen; das merken sie doch gar nicht – und meine gebentschten Kinder brächen nicht zusammen“.
Dass Kerr sich im Exil verstärkt der jüdischen Thematik zuwandte, ist nicht weiter verwunderlich. Er war zeitlebens ein außerordentlich selbstbewusster Jude gewesen, wenngleich ohne religiöse Bindung. Auch wenn sich seine Lebensumstände dramatisch verschlechtert hatten, Kerr behielt seinen Witz: „Ich stamme vom König David, habe drei bis vier Erzengel zu Vettern, und vielleicht war Ahasverus wirklich mein Ur-Onkel aus einer Seitenlinie“. Sein Exil-Schicksal kleidete er in folgenden Vers, womit er sich zugleich mit den nichtjüdischen Vertriebenen solidarisch zeigte: „Juden sind geübte Emigranten,/ Einer tausendjährigen Übung treu,/ Aber unsren Freunden und Bekannten,/ All den christlich-arischen Verbannten /Ist der Zwangsspaziergang ziemlich neu“.
Kerrs Schriften wurden im Mai 1933 öffentlich verbrannt. Und doch trennte der Verfemte sich innerlich nicht von Deutschland. Er kämpfte für ein Deutschland nach Hitler. Allein Kerrs „Gerhart Hauptmanns Schande“ wegen lohnt sich die Buchlektüre. Eine öffentliche Abrechnung, die ihresgleichen sucht! Ein Fluch über Hauptmann, wie man es aus Kerrs Mund bis dahin nicht gekannt hatte, der der Person, nicht dem Werk galt. Mit einem Hauptmann, mit dem ihm auch eine persönliche Freundschaft verbunden hatte, und der sich unmissverständlich mit den „klobigen Gefängniswärtern“, den Nazis, eingelassen hatte, gab es keine Gemeinschaft mehr – „nicht im Leben und nicht im Tod“. Kerr: „Ich kenne diesen Feigling nicht. Und das Bewusstsein der Schande soll ihn würgen in jedem Augenblick. Hauptmann, Gerhart, ist ehrlos geworden.“ Und in jüdisch-sepulkralischer Metaphorik schob er hinterher: „Sein Andenken soll verscharrt sein unter Disteln; sein Bild begraben im Staub“.
Zu seinem geplanten Buch „Ein Jude spricht zu Juden“, eine Doppelbiographie über Marx und Disraeli, kam es nicht mehr. Die Emigration im Februar 1933 machte viele literarische Pläne zunichte. Es gibt nur einen Entwurf.
Im Exil ging Kerrs Hauptkraft in den Kampf gegen Hitler. In diesem Kontext sind die meisten Gedichte nach 1933 zu sehen, viele mit politischem Inhalt. Er spickte seine Gedichte oft mit Kalauern und Gassenjargon, selbsterfundenen Ausdrücken. Die Schärfe der politischen Kommentare nahm zu. „Wenn übermorgen die ganze Hitlerei zusammenstürzt: ich würde trotzdem dieses Land nie mehr betreten; trotz unvermeidlicher Liebe“. Ein andermal formulierte er es unvergleichlich schärfer: „Ich ginge nach Deutschland nie mehr zurück, auch wenn ich es morgen könnte. Ich bin dafür, dass dieses seelisch verjauchte Land von außen her gewaltsam eingerenkt wird“. Ein Verdikt mit dem er bald brach.
All seinen Invektiven zum Trotz kam er nicht aus seiner deutschen Haut heraus und bekannte: „[Ich bin] ein deutscher Dichter, ein deutscher Prosaschreiber. Ich kann nicht hebräisch. Ich kann nicht chaldäisch. Ich kann nicht aramäisch. Ich kann nicht yiddisch. Ich kann deutsch – besser als die Deutschen. Ich bin ein Jude“.
Nach 14 Jahren Exil, zuletzt in London, kam er im Sommer 1947 nach München. Erich Kästner schickt Blumen zur Begrüßung und Kerr notierte: „Bin heute […] wieder in dem Land meiner Liebe, meiner Qual, meiner Jugend. Und meiner Sprache. Diese Trottel wollten mir blitzdumm die Zugehörigkeit absprechen. … Wie komme man sich vor nach allem Vergangenen? Nicht wie ein nachtragender Feind – wahrhaftig nicht. Sondern wie ein erschütterter Gefährte. Erschüttert …, aber misstrauisch“.
Im September 1948 war der 81-jährige besuchsweise zu einer Vortragsreise durch Deutschland aufgebrochen. Zum ersten Mal nach seiner Flucht sah er in Hamburg Shakespeares „Romeo und Julia“. Danach war er sehr erschöpft. Nachts im Hotel traf ihn der Schlag, der ihn halbseitig lähmte. Kurz darauf nahm er eine Überdosis Schlafmittel. „Ich habe das Leben sehr geliebt, aber beendet, als es zur Qual wurde“. Das war am 12. Oktober 1948.
150 Jahre nach seiner Geburt hat Deborah Vietor-Engänder mit ihrer grandiosen Biographie Kerr wieder in das öffentliche Bewusstsein gehoben und ihm den ihm gebührenden Platz in der deutschen Literaturgeschichte zugewiesen.
Deborah Vietor-Engländer: Alfred Kerr. Die Biographie, Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2016, 719 S., 29,95 €
Komplett zu lesen in der Druck- oder Onlineausgabe der Zeitung. Sie können die Zeitung „Jüdische Rundschau“ hier für 39 Euro im Papierform abonnieren oder hier ein Onlinezugang zu den 12 Ausgaben für 33 Euro kaufen.
Sie können auch diesen Artikel komplett lesen, wenn Sie die aktuelle Ausgabe der "Jüdischen Rundschau" hier online mit der Lieferung direkt an Sie per Post bestellen oder jetzt online für 3 Euro statt 3,70 Euro am Kiosk kaufen.